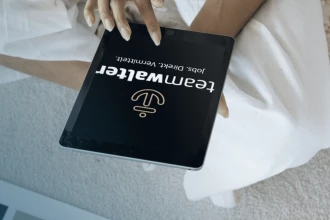🌟 Hinweis zur Sprache
In meinem Text verwende ich bewusst eine neutrale, vereinfachte Sprache ohne gendergerechte Sonderzeichen oder explizite Doppelformen. Mehr dazu findest du am Ende des Artikels.
Was ist Queerbaiting?
Queerbaiting – auf Deutsch etwa: „Queeres Ködern“ – meint eine bewusst eingesetzte Taktik in Medien und Werbung. Queere Themen, Beziehungen oder Identitäten werden angedeutet, angespielt, aufgeladen – aber nie wirklich dargestellt oder ausgesprochen.
Das Ziel?
Ein queeres Publikum* ansprechen, ohne ein konservatives Publikum zu verprellen. Aufmerksamkeit generieren – ohne Haltung zu zeigen.
So entsteht ein vages Versprechen: „Schaut hin, vielleicht ist das hier für euch.“
Aber wer genauer hinsieht, merkt schnell: Die Tür ist nur einen Spalt geöffnet. Und meist bleibt sie das auch.
Wie Queerbaiting funktioniert
Besonders in Serien, Popkultur und Marketing ist Queerbaiting längst zur gängigen Methode geworden:
- In Serien: Zwei weibliche Hauptfiguren*, die sich auffällig intensiv zueinander verhalten. Szenen voller Spannung, emotionale Nähe – aber nie eine klare Liebesgeschichte. Beispiele gab es viele. Immer bleibt es bei der Andeutung – und nie wird ausgesprochen, was viele längst sehen.
- In der Musikszene: Bandmitglieder* spielen mit queeren Codes – sei es in Songtexten, Outfits oder Social-Media-Auftritten. Doch Statements zur eigenen Identität bleiben vage oder aus. Die erzeugte Ambivalenz sorgt für Gesprächsstoff – aber nicht für Sichtbarkeit.
- In der Werbung: Marken zeigen sich im Pride-Monat aufgeschlossen und progressiv. Die Logos sind bunt, die Botschaften laut. Doch abseits vom Juni wird es still. Queere Menschen* kommen in der restlichen Kommunikation kaum vor – oder nur, wenn es sich gut vermarkten lässt.
Kurz gesagt: Queerbaiting nutzt die Strahlkraft queerer Kultur, ohne sich klar zu ihr zu bekennen.
Warum das problematisch ist
Auf den ersten Blick könnte man denken: Ist doch schön, dass queere Themen überhaupt vorkommen.
Doch genau hier liegt das Problem. Denn Queerbaiting bedient Hoffnungen – und lässt sie kontrolliert platzen.
1. Es enttäuscht
Viele queere Personen* sind jahrelang mit dem Gefühl aufgewachsen, nicht dazuzugehören. Wer sich in Andeutungen wiederfindet, klammert sich an sie – manchmal, weil es keine anderen Optionen gibt. Wenn sich diese Anzeichen dann als rein strategisch entpuppen, fühlt sich das an wie ein Rückzug der Wertschätzung.
2. Es instrumentalisiert
Queere Identität wird zur Oberfläche. Zur ästhetischen Anspielung. Zum Tool für Engagement – ohne echtes Interesse an queeren Lebensrealitäten. Das ist keine Repräsentation, das ist Berechnung.
3. Es verhindert Fortschritt
Solange Andeutungen reichen, um Erfolg zu haben, fehlt der Anreiz, tiefer zu erzählen. Echte queere Geschichten, Diversität im Cast und in den Teams* hinter den Kulissen bleiben so oft auf der Strecke.
Und wie sieht echte Repräsentation aus?
Repräsentation heißt nicht, dass jede Story queer sein muss. Es bedeutet, dass queere Menschen dort auftauchen, wo sie real längst leben: überall.*
Echte Repräsentation bedeutet:
- Queere Figuren mit Tiefe, Konflikten, Glück, Identität – und nicht nur als Nebenrolle
- Kreative Verantwortung durch queere Menschen* selbst – hinter der Kamera, auf Bühnen, in Redaktionen
- Klarheit statt Andeutung: Wenn eine Figur queer ist, darf das sichtbar, lebendig, normal sein
- Haltung zeigen – auch außerhalb des Pride Month
Es geht um Realität, nicht um Trend. Um Menschlichkeit, nicht um Stilmittel.
Warum ich das schreibe – und warum gerade jetzt
Als Frau, die selbst queer ist und in der Kommunikationswelt arbeitet, sehe ich täglich die Schnittstellen zwischen Sichtbarkeit und Strategie. Ich sehe, was möglich ist und wo Verantwortung beginnt.
Queere Themen sind keine Mode. Sie sind Leben. Und sie verdienen es, nicht nur angedeutet zu werden, sondern wirklich da zu sein.
Deshalb dieser Text.
Weil Aufmerksamkeit schön ist, aber Respekt besser.
Weil Repräsentation nicht nur eine Geste ist, sondern eine Entscheidung.
Danke fürs Lesen.
– Annsophie ❤️🧡💖🤍💖🧡❤️
🌟 Hinweis zur Sprache
In meinem Text verwende ich bewusst eine neutrale, vereinfachte Sprache ohne gendergerechte Sonderzeichen oder explizite Doppelformen.
Diese Entscheidung hat nichts mit Ausgrenzung zu tun, sondern folgt ausschließlich dem Anspruch an Klarheit, Lesefluss und Zugänglichkeit.
Wenn ich in allgemeiner Form spreche meine ich selbstverständlich alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Identität oder Lebensweise.
Sprache soll uns verbinden – nicht ausgrenzen.